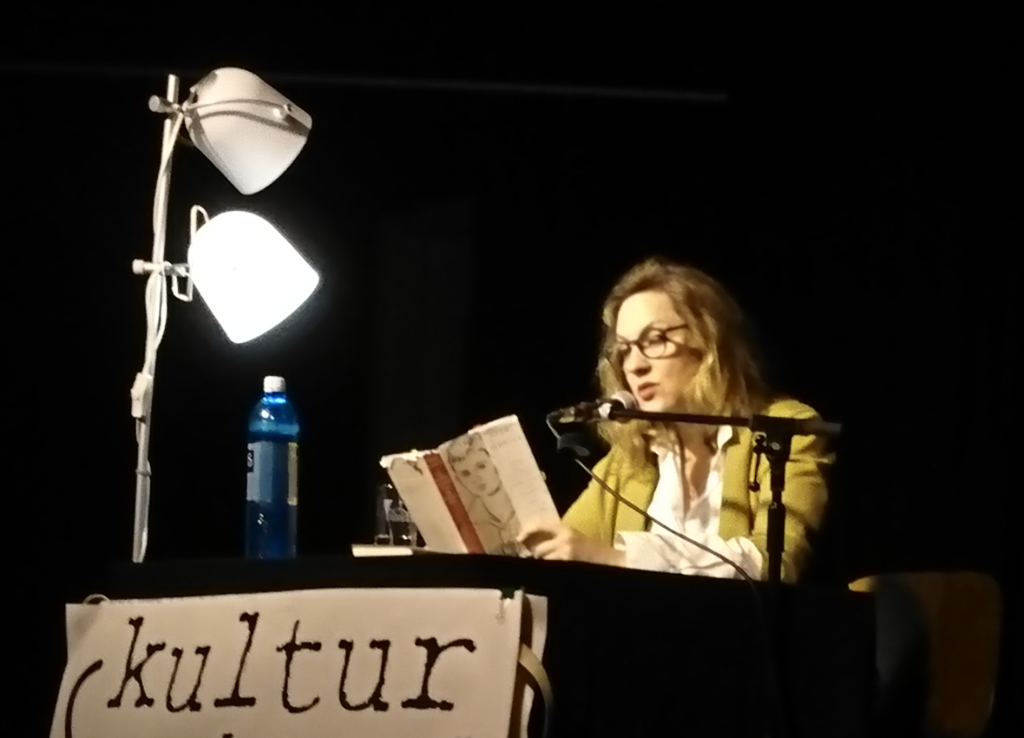Ein Mann und seine Zeit: Der Mann, Naomi Schencks Großvater, lebte für die Wissenschaft. Ordnete er ihr auch die Moral unter? Mit Wärme und Lust am Erzählen rekonstruiert die Enkelin ein Leben im 20. Jahrhundert, das zugleich exzentrisch und exemplarisch war.
Als Günther Schenck (Jahrgang 1913) stirbt, hinterlässt er seiner Enkelin Naomi ein ungewöhnliches Erbe: Sie soll seine Biographie schreiben. Naomi hat den brillanten Chemiker und seine elegante Frau Christel geliebt, doch immer war da ein Gefühl, dass nicht alles gut gelaufen ist in seinem Leben. Als sie sich auf die Suche macht, entdeckt sie, dass ihr vermeintlich unpolitischer Großvater 1933 in die SA eingetreten war. Was bedeutet das? Warum wusste keiner in ihrer Familie davon? Wie treffen Menschen ihre Lebensentscheidungen?
Naomi Schenck stellt die Fragen einer Generation, der die Antworten aus den Geschichtsbüchern nicht ausreichen. Aus eigenen Erinnerungen und Hunderten Geschichten formt sie das lebendige Portrait einer bürgerlichen Familie in Deutschland – und öffnet dem Leser Räume, in denen er unter dem Staub lange zurückliegender Jahre auch ein Stück der eigenen Geschichte entdecken kann.
Ca. 320 Seiten. Gebunden
ISBN 978-3-446-25078-9
Erschienen am 22. Februar 2016
Das Hörbuch erschien zeitgleich bei Hörbuch Hamburg, gelesen von Julia Nachtmann
Hörprobe
Pressestimmen
›Das »gute Umgehen« mit Fakten, Eindrücken und den eigenen, ambivalenten Gefühlen macht den Reiz des Buches aus. Es ist keine stringente Biografie, sondern ein Tasten und Verlaufen, Finden und Vermuten, ein Versuch, die Stimmung zu erfassen, aus der sich der Nazismus entwickeln konnte. … Die Autorin will nicht richten, nicht verurteilen, sondern verstehen.‹
Carsten Hueck, Deutschlandradio Kultur, 16.07.16
Leseprobe
1. Die Erbschaft
Als mein Großvater starb, vermachte er mir keine Reichtümer, dafür aber die Rechte an seiner Biographie, in der ihm eigenen Mischung aus Selbstironie und aufrichtigem Bewusstsein der eigenen Bedeutsamkeit. Oder wusste er noch, dass ich als Kind schon mal ein Buch über ihn schreiben wollte? Ich war damals häufig bei meinen Großeltern gewesen, und mein Großvater – Günther, denn in unserer Familie sprechen auch die Kinder die Erwachsenen mit Vornamen an – war mir so vertraut wie Christel, meine Großmutter, doch er war doppelt so geheimnisvoll. Ich wusste natürlich, dass er Chemiker war, dass er mal ein Max-Planck-Institut geleitet hatte und nun, weißhaarig, Anzug und Fliege tragend, in seinem riesigen Arbeitszimmer immer noch jeden Tag an wichtigen Erfindungen arbeitete.
Weiterlesen
Manchmal hatte ich den Eindruck, dass irgendwas in seinem Leben nicht so gelaufen war, wie es hätte laufen sollen. Was genau das war, das wusste ich nicht, darüber wurde auch nicht gesprochen. Als er viele Jahre später starb, im Herbst 2003, war ich fest entschlossen, die Sache mit der Erbschaft ernst zu nehmen. Ich wollte herausfinden, was für ein Leben mein Großvater geführt hatte. Und wie es mit meinem Leben verbunden war.
Am Abend nach Günthers Tod begleitete ich Geo, meinen Vater, in die Bismarckstraße, in das Haus in Mülheim an der Ruhr, in dem meine Großeltern fast ein halbes Jahrhundert lang gelebt hatten. Wir hielten uns in Günthers Arbeitszimmer auf, in dem von allen Räumen der großen Erdgeschosswohnung seine Präsenz am deutlichsten zu spüren war. Papierstapel, Akten und Bücher lagen auf dem Konferenztisch, auf Sesseln, auf der Couch. Ich setzte mich in seinen schwarzen Drehsessel, hinter dessen Lehne ich mich als Kind gut verstecken konnte und in dem ich mich gern gedreht hatte. Jetzt war das schwarze Leder völlig abgewetzt, was mir fast übertrieben symbolisch vorkam. Als wäre hier ein Filmausstatter am Werk gewesen.
Ich packte Bleistift und Skizzenbuch aus, denn ich wollte eine Zeichnung für die Traueranzeige machen. Zum Glück war mir die Idee mit der Zeichnung gekommen, auf diese Weise konnte ich mich mit ihm beschäftigen, mit seinem Umfeld, seinen Dingen, dem massiven eisernen Locher, dem vergoldeten Brieföffner – und doch nicht zu intensiv. Was immer an Gefühlen aufkäme, könnte ich ableiten, in Striche, Linien und Schraffuren.
Geo hielt sich in der Nähe auf, er war ruhig wie immer, schaute Papiere durch, trank einen Schnaps. Er hatte seinen Vater verloren, ich meinen Großvater, einen Helden meiner Kindheit. An der Wand hing das Aquarell, das Günther als Zwölfjährigen zeigt. Ein aufmerksamer Junge mit blauen Augen, der einen kleinen Gegenstand in der Hand hält. ›Ich vermute, eine Art elektrischer Spule‹, sagte Geo, als er das Bild betrachtete. Unten stand das Jahr: 1925. Es war mir schon früher aufgefallen, dass Günther offenbar ausgerechnet dieses Kinderbildnis an seinem Arbeitsplatz haben wollte, wo zwischen Bücherregalen und mit grünem Wollstoff verhängten Aktenschränken sonst nur ein nachgedunkeltes Ölporträt seines Vaters, eine gerahmte Fotografie seines Mentors und Doktorvaters Karl Ziegler und ein abstraktes, düsteres Gemälde aus Japan hingen.
Zu dem Gemälde gab es eine Geschichte: Günther hatte mit ein paar Leuten im Schloss Hugenpoet in Kettwig zu Abend gegessen. Am Nebentisch ereignete sich ein kleiner Aufruhr; offensichtlich ging es einem der Gäste, einem Japaner, nicht gut. Wissend, dass Günther einen Professorentitel hatte, bat der Oberkellner ihn um Hilfe. Günther war kein Arzt, aber das war auch nicht nötig, denn der Mann war, wie er mit ein paar Fragen herausfand, einfach erschöpft vom langen Flug und vom Jetlag. Günther ordnete an, dass ihm sofort ein Hotelzimmer und eine Flasche Champagner zur Verfügung gestellt werde, und so geschah es. Drei Monate später kam ein großes Paket aus Japan an. Ein großes, gerahmtes Ölbild und eine Grußkarte: ›Mit herzlichem Dank für erste Hilfe, Champagner und Mädchen.‹ Das mit dem Mädchen habe ich nie ganz aufklären können. Christel, meine Großmutter, meinte, damit sei das Zimmermädchen gemeint gewesen, das den Champagner brachte.
Jetzt stand ich vor dem Bild und überlegte, ob es mir etwas sagte, seine Düsterkeit, die pastosen grauen Flächen, der seltsame dicke Turm, der oben eine Art Antenne hatte.
Bilder, Möbel, Bücher – es ging jetzt darum, zu entscheiden, was mit den Dingen geschehen sollte, doch dafür waren vor allem mein Vater und seine Geschwister zuständig. Es war noch nicht geklärt, ob sie das Erbe überhaupt annehmen würden, sie wollten sich zunächst einen Überblick über Günthers Schulden verschaffen. Bis zuletzt von der Wichtigkeit seiner Arbeit überzeugt, hatte er sein Gehalt als emeritierter Professor und noch mehr in sein Sekretariat und in Patentgebühren gesteckt. Das Haus gehörte der Max-Planck-Gesellschaft und kostete Miete.
Seinen Tod hatte mein Großvater bereits Mitte der sechziger Jahre sorgsam vorbereitet, als er aufgrund einer spät diagnostizierten Autoimmunkrankheit mit seinem Ableben rechnete, wie er es ausdrückte. Die Details für seine Beerdigung waren also seit langem geklärt: Zur Aufbahrung sollte er in einen Smoking gekleidet werden, und alle Institutsmitarbeiter sollten nach der Beerdigung so lange auf seine Rechnung essen und trinken können, wie sie wollten.
In letzter Zeit hatte er sich weitere Gedanken gemacht. Er hatte mich gefragt, ob mir das rote Teeservice mit dem Margeritenmuster gefiel. Als ich bejahte, sagte er, dann sollst du das haben. Und bei einer anderen Gelegenheit hatte er mir beiläufig, aber auch ein wenig feierlich mitgeteilt, er wolle mir die Rechte an seiner Biographie vermachen.
Im Safe fand sich dann tatsächlich ein entsprechender Vermerk. Als älteste Enkelin stand ich ganz oben auf der Liste: Naomi, Biographie G. O. Schenck.
Als Achtjährige hatte ich schon einmal damit begonnen, sein Leben aufzuschreiben. ›Mein Opa Günther‹ sollte das Buch heißen und von einem Wissenschaftler handeln, der Klarinette und Cello spielte, stets orangefarbene Schuhe im Kofferraum hatte und die Delphine im Duisburger Zoo rettete. Lugte sein Taschentuch aus der Brusttasche weiter heraus als normal, dachte er gerade über etwas Wichtiges nach und durfte auf keinen Fall angesprochen werden. Außerdem war es nicht ratsam, ihm von hinten die Augen zuzuhalten, denn er war Träger des schwarzen Gürtels und hatte mal jemanden, der hinter ihm aufgetaucht war, mit beiden Armen gegriffen und über den Tisch geschleudert. Wenn Gäste zum Abendessen da waren, kam es manchmal vor, dass er verschwand und meine Großmutter ihn schließlich in der Badewanne vorfand.
Es gab viele solcher Anekdoten, außerdem war da die schiere Spanne seines Lebens, die vom Vorabend des Ersten Weltkriegs bis nach dem Anschlag auf das World Trade Center reichte. Mir fiel ein, dass ich irgendwann schon mal mit vagen Absichten eine Schenck-Kiste angelegt hatte, in der sich seine Weihnachtsbriefe befanden, Fotos, besprochene Cassetten und fotokopierte Publikationen mit jeder Menge Formeln, die mir nichts sagten. Obwohl mein Vater ebenfalls Chemiker war, hatte ich in Chemie immer zwischen fünf und sechs gestanden und das Fach abgewählt, sobald es ging. Später hatte ich Kunst studiert und war schließlich Szenenbildnerin geworden. Außerdem schrieb ich Kurzgeschichten und Hörspiele. Damit hatte es wohl zu tun, dass Günther mir die Aufgabe seiner Biographie übertragen hatte – obwohl er wusste, dass ich kaum etwas von seiner wissenschaftlichen Hinterlassenschaft verstand.
Meine Geschwister hatten jedenfalls ihrer Ausbildung entsprechende Aufgaben erhalten. Jost, der Jurist, wurde zum Zuständigen für die rechtlichen Belange der Firmen erklärt, die sich aus Günthers Patenten ergeben würden; Toby, der eine eigene Softwarefirma hat, sollte im Aufsichtsrat die Familieninteressen vertreten. Beide hatten dafür eher eine Art müdes Lächeln übrig.
›Und was hat Günther dir vererbt?‹, fragte ich meine Schwester Hanna, die Philosophie studierte.
›Ich soll mich um die Weiterentwicklung seiner wissenschaftstheoretischen Ansätze kümmern.‹
Sie klang etwas genervt. ›Er hat da mal so eine Liste gemacht, zur Vermeidung von Denkfehlern in der Wissenschaft‹, sagte sie. ›Wahrscheinlich finde ich die auch noch irgendwo. Wobei ich die jetzt nicht so wahnsinnig originell fand.‹
›Was stand denn da so?‹
›Vor allem hat er immer vor geistigen Epidemien gewarnt.‹
›So was wie Nationalsozialismus?‹
›Genau, aber auch andere Sachen, die wie bei einer Hysterie um sich greifen und die Leute dann irgendwie völlig vereinnahmen. Er wollte, dass man die Dinge anhand einer Fragenliste überprüft, bevor man sie behauptet.‹
›Ging’s da auch ums Waldsterben?‹
Ich dachte an seine Schimpftiraden über Politiker, die wissenschaftlich unfundiertes Zeug redeten. Seinen Ärger über die Grünen, die über das Waldsterben debattierten, aber keine Ahnung hatten. Und ausgerechnet die hörten ihm dann zu, als er Mitte der achtziger Jahre seine unorthodoxen Ideen zu dem Thema in der europäischen Fachpresse veröffentlichte.
›Ja, genau! Das war eines seiner Beispiele.‹
Das mit den Denkfehlern notierte ich mir. Warum nicht gleich anfangen und schauen, wohin mich das führte? Außerdem wollte ich bei der Beerdigung in Heidelberg ein paar Worte sagen. Ich war zu dieser Zeit gerade dabei, meine Scheu vor öffentlichem Sprechen abzulegen, und wollte die Gelegenheit zum Üben nutzen.
Eine freie Rede wurde es nicht; ich las den kurzen Text vom Blatt ab. Ich sprach davon, wie Günther zwei Tage vor seinem Tod im Krankenhaus gesagt hatte: ›Ich sterbe, aber ich will nicht sterben.‹ Und ich erzählte, dass er bis kurz vor dem Ende die Spülmaschine eigenhändig ausgeräumt hatte, mit geschlossenen Augen, um im Training zu bleiben, wie er sagte.
Günther hatte sich für eine Feuerbestattung entschieden, das stand schon lange fest. Ich fand das okay. Wenn es so weit wäre, darüber nachzudenken, würde ich mich vielleicht auch lieber verbrennen lassen. Ein paar Wochen zuvor erst hatte ich für einen Tatort einen Friedhof mit Krematorium gesucht, in dem zwei Szenen gedreht werden sollten. In Krefeld wurde ich fündig, bei den pompösen Marmorgräbern der Sinti und Roma. Der Friedhofsangestellte erklärte mir das Krematorium. Den Ofen konnte er nicht für mich anwerfen, aber er zeigte mir eine Art Kehrblech und ein Sieb, mit dem man nach der Verbrennung des Körpers noch mal die Asche filtert. Falls doch irgendwelche Metallstücke, zum Beispiel Schmuck, zurückgeblieben waren.
Am Morgen nach der Beerdigung stieg ich in den ersten ICE von Mannheim nach Berlin. Sanft glitten die Waggons durch die Dunkelheit, die anderen Fahrgäste schliefen oder arbeiteten lautlos an ihren Laptops. Ich schaute aus dem Fenster, in dem sich das Abteil spiegelte und sich wie eine Folie über den Hafen legte, die vorbeiziehenden Lichter der Industrieanlagen auf der anderen Rheinseite, über noch dunkel daliegende Mietshäuser, dann kleine Wälder, Felder und Höfe. Ich dachte über mein Projekt nach. Wie könnte ein Buch über Günther beginnen? Mit einem Blick aus einem Zug, über Landschaften, Steinbrüche, Wälder? Aber mit dem Zug ist er so gut wie nie gereist. Dafür saß er umso öfter am Steuer seines weißen Mercedes-Kombi, der später schon recht verrostet war und hinten ganz eingebeult vom Einparken. Als Kind hatte ich den Eindruck, er würde wahnsinnig rasen. Einmal kamen wir aus irgendeinem Kurort, an den ich meine Großeltern übers Wochenende begleitet hatte, und ich fing auf dem Rücksitz an zu weinen, weil ich sicher war, unsere letzte Stunde habe geschlagen. Die zitternde Nadel des Tachometers zeigte hundertdreißig Stundenkilometer an.
Als es heller wurde und ein Kaffeewagen vorbeigeschoben wurde, packte ich meinen Computer aus und legte ein Dokument mit dem Namen ›Günther‹ an. Ich schrieb ein paar Erinnerungen auf, doch dann wanderten meine Gedanken zu den bevorstehenden Wochen. Nach zwei Monaten ohne Engagement hatte ich endlich wieder einen Job an Land gezogen. Obwohl es für die Filmbranche normal war, dass das neue Jahr nach den Wintermonaten erst allmählich begann, hatte die Zeit als Bohemien wider Willen nicht nur an meinem Konto, sondern auch ein wenig an meinem Selbstbild genagt. Ich schloss die Günther-Datei und öffnete die Drehbuchfassung, die mir die Filmproduktion am Vortag geschickt hatte. Ich erstellte die Motivliste: Haus Tellmann. Villa Binz. Schrebergartensiedlung. Rasthaus am See.
(…)
Am Abend meiner Rückkehr von Günthers Beerdigung kam Claus vorbei und lud mich zum Italiener ein. Er wollte mit mir meinen ersten Arbeitstag am neuen Film feiern. Ich teilte ihm mit, dass ich beschlossen hatte, ein Buch über meinen Großvater zu schreiben. Wider Erwarten war er nicht begeistert, sondern schaute mich fast mitleidig an. ›So weit ist es jetzt schon?‹, sagte er zweifelnd. Er hatte Günther nie kennengelernt, war aber überzeugt, dass ich ihn idealisierte, wie meine ganze Familie. ›Da zucken doch alle zusammen, wenn man etwas gegen ihn sagt!‹
›Quatsch. Ich sehe ihn auch kritisch. Glaub mir, das wird interessant!‹
Ich zählte ihm auf, was mir an Highlights so einfiel: die Operation Paperclip, in deren Rahmen die Amerikaner ihn und andere Wissenschaftler bei Kriegsende aus den russischen Gebieten evakuierten; seine Zeit als Jazzmusiker; sein Chemielabor im Garten, wo er in den Nachkriegsjahren ein dringend benötigtes Medikament gegen Würmer herstellte. Dass er irgendwann in den sechziger Jahren die drei Kinder fragte: Wollen wir uns ein Haus kaufen, oder wollen wir für ein Jahr nach Amerika gehen? Und die Familie dann natürlich nach Amerika ging. Ich ließ Namen von Leuten wie Otto Hahn, Otto Bayer oder Otto Warburg fallen, über die in der Bismarckstraße Geschichten aus der Zeit kursierten, als Günther mit ihnen zu tun hatte; natürlich allen voran Karl Ziegler, der Mann, der mit seinem Niederdruck-Polyethylen das Zeitalter des Plastik eingeläutet hatte.
Günthers Beziehung zu Ziegler war prägend für ihn gewesen, hatte aber irgendwie nicht gut geendet, ohne dass ich genau wusste, warum eigentlich. An Claus’ Rückfragen merkte ich, wie viel ich würde recherchieren müssen. Aber es hatte ja keine Eile. Jetzt kam erst mal der Film.
Und der wurde anstrengend. Zwei Monate Motivsuche und Vorbereitung nahmen meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. Gelegentlich rief Dagmar an, meine Mutter, um zu fragen, ob ich etwas Bestimmtes aus der Bismarckstraße haben wollte oder nicht. Bevor sie es auf den Müll gaben. Die schönen Sachen, die Musikinstrumente, die Bilder, das Silber, waren ohnehin längst auf die große Familie verteilt. Ich hatte unter anderem zwei schöne Metalldosen aus seiner Sammlung nummerierter Tees an Land gezogen, Tee Nummer 5 (erdig duftende graubraune Kügelchen) und Nummer 17, dessen Jasminduft mich an gemütlich verregnete Nachmittage in der Bismarckstraße erinnerte. Und ich liebte Christels dänisches Teakholz-Bänkchen, das in der Diele vor den Fortschritt-Bücherregalen gestanden hatte, mit hellroten Kissen. Das stand jetzt bei mir in Berlin unter dem Balkonfenster. Ich hatte es als meinen neuen Lieblingsplatz eingerichtet, um mit Claus zu skypen, der während dieser Zeit häufig in seinem Atelier in Mitte blieb. Eine Ausstellung kam auf ihn zu, er malte. An unserem vierten Jahrestag gingen wir zu einem Konzert der Einstürzenden Neubauten. Am Wochenende spielten wir Pingpong, um den Kopf freizukriegen, über verfehlte Bälle zu fluchen und das Verlieren zu lernen.
Einmal flocht sich die Bismarckstraße intensiv in meinen Filmalltag. Das war die Sache mit den Büchern, die verbrannt werden sollten.
Das letzte große Motiv des Filmes war die Villa Binz, in der die Bibliothek eines Historikers brennen sollte. Wir fanden ein denkmalgeschütztes Haus im Wald mit Türmchen und Bleiglasfenstern, deren Besitzer cool genug waren, unseren Spezialeffektlern zu erlauben, Feuer zu legen.
Das größte Problem waren zum Schluss die Bücher. Einundachtzig laufende Meter Bücher waren nach unseren Berechnungen nötig, um die Regale zu füllen. Selbst bei Emmaus kostete eine Kiste (weniger als ein laufender Meter) zwanzig Euro. Das war ein echtes Problem für unser Budget.
Ich dachte an Günthers Bücher. Die Kunstbände waren natürlich längst weg, die wissenschaftlichen Werke waren im Institut, ein paar Erstausgaben im Antiquariat. Übrig war nun der ganze Rest, und der lagerte in Umzugskartons und Bananenkisten unter dem Carport meiner Eltern. Selbst die Diakonie hatte es aus Platzgründen abgelehnt, sie anzunehmen. Meine Mutter rief immer mal wieder an, um die tollen Bücher anzupreisen, wahre Schätze, von denen wir uns doch unbedingt noch einige aussuchen sollten. Zum Altpapier wollten sie sie nicht geben. Es waren doch Bücher …
Die Idee lag nahe. Ich bewegte sie eine Weile in meinem Kopf. Ich wollte sicher sein, nicht pietätlos zu handeln. Aber es passte einfach.
Ich pitchte meinem Vater die Sache.
›Stell dir vor, die Bücher werden nicht weggeworfen, sondern verbrannt. Und das Ganze wird sogar auf Zelluloid gebannt und wird im Film zu sehen sein.‹ Einige Sekunden Stille. So lange brauchte Geo, um sich selber die Pietätsfrage zu beantworten. Dann lachte er und meinte, das passte zu Günther, zu seinem Faible für dramatische Abgänge. Er sprach mit seinen Geschwistern, mit Gudrun in Heidelberg und Billi in München. Alle gaben grünes Licht.
Der Requisitenfahrer fuhr mit dem leeren Sprinter nach Mülheim und kam mit der Ladung Bücher aus der Bismarckstraße zurück. Das Motiv war bereits halb eingerichtet. Die Spezialeffektler hatten das vordere Zimmer komplett feuerfest verschalt, ohne ein einziges Bohrloch zu verursachen. Die Platten waren nur eingekeilt, und doch bombenfest, wie mir der Bauleiter anhand eines Klimmzugs vorführte. Ein nur wenige Zentimeter kleinerer Raum im Raum war entstanden; er erinnerte an die Kunstinstallation Haus ur von Gregor Schneider. Dann begannen wir mit der zu verbrennenden Einrichtung. Alte Teppiche, kaputte Lampenschirme und ein ausgesessener Ohrensessel, die vor der Kamera, so hoffte ich, edel genug wirken würden. Alles wurde mit Brennpaste eingeschmiert. Auch die Regale aus leicht brennbarem Holz, die vor Ort noch braun angemalt wurden.
Gemeinsam mit zwei Kollegen räumte ich die Bücher meiner Großeltern in die Regale. Immer drei oder vier Bücher konnte ich greifen, auf die Titel achtete ich nicht. Manchmal war was Französisches dabei. Falls ein Handorakel von Balthasar Gracián darunter wäre, würde es mir aber sicher auffallen, dachte ich, es würde aus all den bräunlichen Büchern herausleuchten. Die Kunst der Weltklugheit, wie das Werk im Untertitel heißt, war Günthers Lieblingsbuch gewesen, er hatte es oft verschenkt, und in der Bismarckstraße entdeckte ich immer wieder andere Ausgaben und wunderte mich darüber, wie viele davon im Umlauf waren: Hardcover und Taschenbücher und Editionen aus verschiedenen Jahrzehnten, in einigen steckten gelbe Klebezettel, in andere hatte er seine Notizen mit Kugelschreiber oder Bleistift notiert.
Jemand reichte mir ein paar beschriebene Karteikarten, die als Lesezeichen in Büchern steckten. Meist chemische Formeln. Eine Sprache, die ich nicht verstand. Aber Günthers Handschrift war mir beinahe so vertraut wie meine eigene.
Die Requisiteurin schaute mich vielsagend an, vorwurfsvoll. Obwohl ich es ihr erklärt hatte, verstand sie nicht, wie ich so etwas machen konnte. Die Bücher meines Großvaters für einen Film verheizen. Ich selber war mir plötzlich nicht mehr sicher.
Während wir im Garten auf die Dunkelheit warteten, wurden im Haus die letzten Leitungen gelegt, Equipment gesichert, Kerosin im Set versprüht. Der Spezialeffektler warf alle aus dem Set und brüllte mehr als nötig, der Aufnahmeleiter wiederholte die Ansagen seinerseits schreiend. Das Team verzog sich wie eine bummelnde Schafherde in den Garten, zu den Kollegen hinter die Monitore.
Einige wenige Auserwählte wie der Tonmeister, der mit seinem Tonwagen einen Sonderplatz in der Küche hatte, durften bleiben. Von meinem Platz unter einem Baum sah ich, wie er sich noch mal in den Bücherraum stahl, kurz bevor es losging. Mit schräg geneigtem Kopf stand er vorm Regal, betrachtete die Bücher, zog eines heraus. Später zeigte er es mir: John Muir, Die Berge Kaliforniens.
Dann brannte das Feuer, kontrolliert und kräftig. Sein Licht überstrahlte die Bücher. Erst später, in den nahen Einstellungen, erkannte ich am Monitor einzelne angesengte Buchseiten, die der Innenrequisiteur mit Aschefetzen ins Bild pustete.
Dem Film folgten weitere Filme, und es vergingen Jahre, in denen mich immer etwas davon abhielt, das Günther-Projekt in Angriff zu nehmen. Manchmal fiel es mir ein, zum Beispiel, wenn ich in Mülheim bei meinen Eltern war oder bei meinen Geschwistern, die Familien gründeten und Kinder bekamen, die ihre Urgroßeltern nie kennenlernen würden. Doch Günthers Leben blieb ungeschrieben. Es ist wichtig, aber nicht dringend, sagte ich mir und vertraute darauf, dass die richtige Zeit dafür kommen würde. Und so geschah es dann auch, aber anders, als ich es mir vorgestellt hatte – nicht in Form einer Inspiration, sondern als eine verstörende Überraschung.
Ich hatte Toby angerufen, um ihm zum Geburtstag zu gratulieren, und meine Nichte Henriette war ans Telefon gegangen. Sie kam gerade vom Karate und musste gleich weiter zu ihrer Robotik-Gruppe, wo sie Roboter baute und programmierte, die in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antraten. Wir plauderten kurz, und sie erzählte mir, dass sie neulich etwas im Internet recherchieren musste und aus Langeweile zwischendurch googelte, was es eigentlich über ihre Familie zu finden gab. Und dabei stieß sie auf einen Wikipedia-Eintrag über ihren Urgroßvater Günther Otto Schenck. ›Aber da stand nicht viel‹, sagte Henriette. ›Nur, wo er geboren wurde und wann er gestorben ist. Und welche Auszeichnungen er hatte.‹
Seltsam, dass ich selbst nie auf die Idee gekommen war, Günther einfach mal zu googeln. Nach dem Telefonat setzte ich mich an den Computer und fand den Eintrag.
›Günther Otto Schenck war ein deutscher Chemiker‹, stand da. ›Er trat im November 1933 der SA bei und war seit 1. Mai 1937 Mitglied der NSDAP. Er war Professor für Chemie in Göttingen und Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für Strahlenchemie in Mülheim an der Ruhr.‹
Das mit der NSDAP wusste ich. Günther hatte mir erzählt, dass ein Freund ihn einfach dort eingetragen hatte. Um ihn zu schützen. Und wenn man einmal drin war, trat man besser nicht aus.
Von der SA wusste ich nichts.
2. Bismarckstraße
›Your grandfather was a chemist in Germany?‹, hatte die jüdische Psychotherapeutin gesagt. ›What did he do during the war?‹
Das war vor Jahren gewesen, in Kalifornien. ›Oh, da sind Sie auf dem falschen Dampfer‹, hatte ich geantwortet. ›Das sagen zwar viele, aber in meinem Fall war es tatsächlich so: Meine Familie war eine Ausnahme.‹ Meine Großmutter sei so streng katholisch erzogen gewesen, dass sie beim Hochrecken des rechten Arms immer schnell das Vaterunser aufsagte, erzählte ich und wahrscheinlich auch die Geschichte, wie Günther beim Gesundheitsamt darum gebeten hatte, man möge ihm den Ariernachweis doch als Stempel auf den Hintern geben, dann müsse er bei Bedarf nur die Hose herunterlassen. Die Therapeutin schaute mich lange an. Sie sagte nichts, sie ließ mich reden. Das ist wohl eine bestimmte Therapieform. Ich kam mir vor wie jemand, der etwas vertuscht.
Vertuschen ist etwas, das nicht zu unserer Familie passt. Es wird viel gesprochen. Man hat das Gefühl, man kann über alles reden. Geo hat mir erzählt, das sei ihm als Kind auch schon so gegangen, und das war in den fünfziger Jahren sicher noch ungewöhnlicher als heute.
Aber dass man das Gefühl hat, heißt ja nicht, dass es tatsächlich so war, denke ich. Oder heute so ist.
(…)