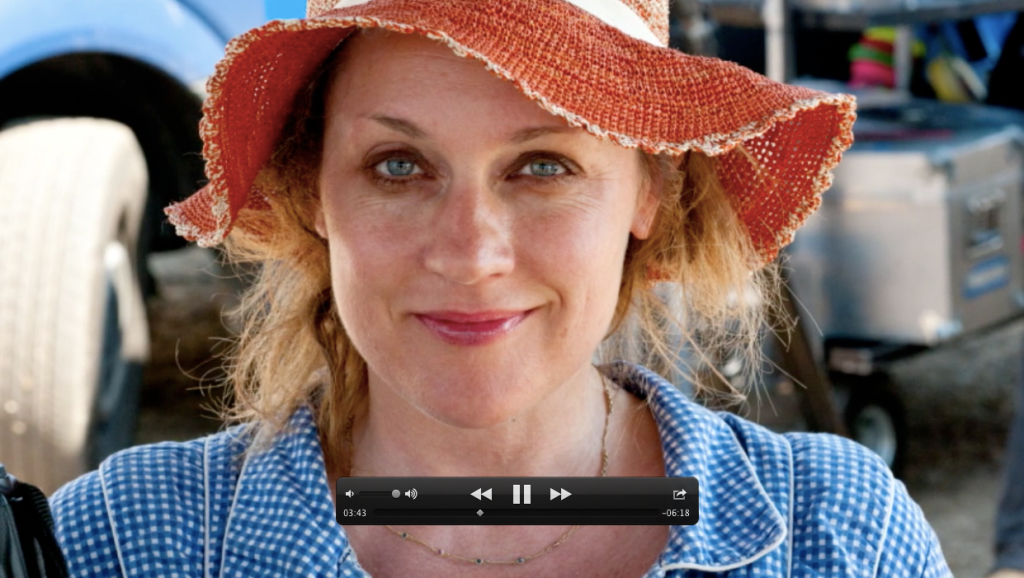Filmographie
Reihen
›Der Hammer‹ (Tatort Münster), Regie: Lars Kraume
›Eine andere Welt‹ (Tatort Dortmund), Regie: Andreas Herzog
›Summ, Summ, Summ‹, Regie: Kaspar Heidelbach Tatort Köln)
›Scheinwelten‹ (Tatort Dortmund), Regie: Andreas Herzog
›Hinkebein‹ (Tatort Münster), Regie: Manfred Stelzer
›Altes Eisen‹ (Tatort Köln), Regie: Mark Schlichter
›Familienbande‹ (Tatort Köln), Regie: Thomas Jauch
›Schuld und Sühne‹ (Schimanski), Regie: Thomas Jauch
›Rabenherz‹ (Tatort Köln), Regie: Thorsten C. Fischer
›Ruhe Sanft‹ (Tatort Münster), Regie: Manfred Stelzer
›Dreimal Schwarzer Kater‹ (Tatort Münster), Regie: Buddy Giovinazzo
›Sehnsucht‹ (Schimanski), Regie: Hajo Gies
›Rattennest‹ (Schimanski), Regie: Hajo Gies
›Wir sind die Polizei‹ (Nachtschicht), Regie: Lars Becker
›Das tote Mädchen‹, (Nachtschicht), Regie: Lars Becker
›Blutige Stadt‹, (Nachtschicht), Regie: Lars Becker
›Ich habe Angst‹, (Nachtschicht), Regie: Lars Becker
90-Minüter um 20:15h
›Liebesjahre‹, Regie: Matti Geschonneck
›Verdacht‹, Regie: Matti Geschonneck
›Tod einer Polizistin‹, Regie: Matti Geschonneck
›Verloren auf Borneo‹, Regie: Ulli Baumann
›Schatten d. Gerechtigkeit‹, Regie: Hans Günter Bücking
›Meine Frau, ihr Traummann und ich‹, Regie: Walter Weber
›Amigo – Bei Ankunft Tod‹, Regie: Lars Becker
Serien
›Lotta‹, Regie: Joseph Orr
›Katie Fforde‹, Regie: John Delbridge
›Da kommt Kalle‹, Regie: Lars Jessen
›Der Fahnder‹, Regie: Peter Adam u. a.
›Die Partner‹, Regie: Josef Rusnak, Samir u. a.
Kino
›Spun‹ (Innenrequisite), Regie: Jonas Akerlund
›Kanak Attack‹ (Ausstattung), Regie: Lars Becker
›Prinzessin‹ (Szenenbild), Regie: Birgit Großkopf
Erna
Ich war 22, seit knapp zwei Jahren an der Kunstakademie und vollkommen orientierungslos. Mit dem, was ich für meine Begabung hielt, dem Zeichnen, kam ich nicht weiter. Malerei, Bühnenbild, Konzeptuelles – in der freien Kunst war angeblich alles möglich, aber was ich zu bieten hatte, war leider uncool. Vor allem wenn ich es mit den Augen der anderen sah. Als ich dann mal beim Werbefilm eines Freundes aushalf, erwachte in mir die vage Hoffnung, dass Film vielleicht etwas wäre, das Arbeiten im Team, wo es klare Aufgaben gäbe. Kurz darauf standen große LKW vor der Kunstakademie und Kabel führten den Seiteneingang hinauf. Es wurde ein Düsseldorf-Tatort gedreht. ›Mord in der Akademie.‹ In der ersten Etage, vor der Lüpertz- und der Graubner-Klasse stand zwischen Scheinwerfern, Tonwagen und Brötchentabletts lautlos wartend das Team. Ich stellte mich dazu und sprach in einer Drehpause einen schlacksigen Blonden mit Geheimratsecken an. An wen wende ich mich, wenn ich mal ein Praktikum machen möchte? Er deutete auf einen kleineren, gedrungenen Mann mit schütterem schwarzen Haar. Das ist der Produktionsleiter.
Anderntags traf ich den Produktionsleiter im Op de Eck und er sagte, sie seien tatsächlich auf der Suche nach einer Praktikantin – allerdings im Schneideraum. Ich hatte keine Ahnung, was Schneideraum bedeutete. Das ist okay für mich! Und Sie müssten am kommenden Montag in München anfangen. Kein Problem, sagte ich. Bis dahin waren es ja noch fünfeinhalb Tage. Mein Mann, ein Kommilitone aus der Rinke-Klasse, den ich erst ein halbes Jahr zuvor geheiratet hatte, um seine Abschiebung nach Serbien zu verhindern, hatte Verständnis und half mir mit dem Packen. Über meine Kusine fand ich ein Zimmer, das ich im teuren München untermieten konnte– in einem Plattenbau am unteren Ende der Prinzregentenstraße. Von dort aus fuhr ich nun drei Monate lang jeden Morgen, noch im Dunklen, mit der Straßenbahn in den bewaldeten Süden der Stadt, wo hinter einer Schranke das Gelände der Bavaria Film lag. Zwischen asphaltierten Parkplätzen und Studiobauten lag das Gebäude mit den Schneideräumen, und darin, am Ende eines langen Flurs auch jener nach altem Holz riechende Raum mit dem verdunkelten Fenster und den drei Schneidetischen aus blaugrauem Stahl, in dem ich nun meine Tage verbrachte. Acht Stunden, bis ich abends wieder mit der Straßenbahn zurückfuhr. Die Schneidetische waren aus massivem Eisen, schwere Maschinen im Hammerschlag Look. Filmspulen lagen horizontal darauf wie grobschlächtige Plattenteller, dazwischen alle möglichen altmodischen Hebel und Knöpfe. In der Mitte hing jeweils ein von Metallklappen abgeschirmter uralt wirkenden Bildschirm, auf dem in körniger Auflösung Ausschnitte der in der Kunstakademie gedrehten Szenen zu sehen waren. Hinter dem größten Tisch saß, vergleichsweise winzig, die Cutterin, eine mausartige Frau mit silberner Prinz-Eisenherz-Frisur, die stetig leise oder auch lauter in ihrem breiten Bayerisch vor sich hin schimpfte, meist über eine Person namens Erna – die ich nicht kannte aber die mir leid tat, weil sich unablässig über sie beklagt wurde (meine schüchterne Frage, wer Erna sei, wurde nie beantwortet). Am mittleren Tisch saß die Cutterassistentin, eine schweigsame Amazone mit asymmetrischem Haarschnitt und einem Ohrläppchen voll Silberstecker. Vorne bei der Tür, am kleinsten der blauen Eisentische, saß ich. Und bei mir stand der sogenannte Galgen. Ein hölzernes Gestell mit feinen Nägelchen, an denen bräunliche 16mm-Filmstreifen hingen. Meine Aufgabe war es, die Streifen von meinem Galgen nach und nach an einer bestimmten Stelle mit einer speziellen Klebepresse abzuschneiden, den nächsten Filmstreifen mit Tesafilm daran kleben und das zusammengeklebte Filmstreifen-Doppel in der richtigen Reihenfolge wieder an den Galgen zu hängen. Es war komplizierter, als es sich anhört, jedenfalls gab es Raum für Fehler. Und obwohl ich mich konzentrierte, machte ich immer wieder etwas falsch, und mit der Zeit ahnte ich erst, dass das Geschimpfe der Cutterin nicht nur dieser Erna galt, sondern auch mir, und dann, dass es gar keine Erna gab, sondern dass Erna bayerisch war für ›Ihrer‹, ›Ihnen‹ oder ›Sie‹. ›Hab ich Erna doch gesagt! … Erna versteht einfach nicht, dass …‹ Als ich verstand, dass Erna und ich eins waren, stieg mir die Schamesröte ins Gesicht, aber im Halbdunkel sah das niemand, und ich konnte ja auch nichts machen, als mich weiterhin zu bemühen. Das Erna-Gemecker gehörte weiterhin zum Soundtrack meines Schneideraum-Alltags, genauso wie die immer selben Dialogfetzen der Schauspieler, verschluckt von einsaugenden Schlurfgeräuschen. Und obwohl Erna dem Zetern der Cutterin zufolge ein hoffnungsloser Fall war, erweiterte sich mein Aufgabenbereich mit der Zeit. Ich durfte nun auch die Ton- und Bildstreifen ›anlegen‹, dafür den Tonstreifen an die Stelle fahren, an der auf dem Bildstreifen die Klappe zuschlägt, und genoss das befriedigende Gefühl, wenn die Lippenbewegungen der Schauspielerin mit ihren über Kopfhörer an meine Ohren dringenden Worten synchron übereinstimmten, in genau dem Zeitlupentempo, das ich selbst durch das Drehen an einem kleinen Rädchen vorgab. Auf dem körnigen Bildschirm sah ich immer wieder die mir so wohlbekannten riesigen Sprossenfenster der Kunstakademie, den neun Meter hohen Flur mit dem Terrazzoboden und den nackten Zeigern der Sechziger-Jahre-Uhr an der Wand, die ich so oft angeschaut habe, wenn ich dort hinabgegangen war. Völlig unrealistischerweise wird in der Lüpertz-Klasse getöpfert, eine Studentin sitzt hinter einem großen, sich drehenden tonweißes Gefäß, das sie mit nassen Händen formt; als der Mörder von hinten seine Hände um ihren Hals legt, greifen ihre Hände blind in den Ton, die bauchige Amphore gerät ins Eiern und ins Schlingern; die erfolgreiche Erwürgung ahnt man, als die vormals elegante Form zu einem unförmigen Klumpen verfällt. Die Szene mit der Ermordung der Studentin und das ständige Wieder-Anschauen meiner täglichen Wege an der Kunstakademie kam mir einerseits völlig normal vor und zugleich seltsam symbolisch. Als würde ich dabei zusehen, wie ich mich selbst mich von meinem dort nicht mehr weiterführenden Weg entferne, im Weggehen jedoch auf der Stelle trete. Denn es kamen ja immer wieder neue Variante derselben oder ähnlicher Szenen. Die Vernehmung der Verdächtigen, ihre ständige Wiederholung der immer selben Sätze, durch deren ständige Wiederholung sich eine seltsame Neutralisierendes stattfindet, bei der es nicht mehr um Inhalt, sondern nur noch um Form geht, um kleinste Veränderungen in der Aussprache. Und das über viele Stunden am Tag und fünf Tage in der Woche. Ich fragte mich, wie in diesem Schneckentempo jemals die Szenen zusammenkommen sollen die dann geschnitten einen ganzen Film ergeben. Abwechslung gab es in meinen Tagen nur, wenn ich mal neue Filmrollen an der Poststelle abholen durfte, oder am frühen Abend der Regisseur vorbeikam und der Kameramann. Beim Mustergucken am großen Schreibtisch der Cutterin stand ich hinter der Cutterassistentin und sah von hier aus den anderen zusammen die immer selbe Szene in unterschiedlichen Varianten, von denen der Regisseur jeweils eine oder zwei auswählte. Später gab es auch mal zwölf- oder fünfzehnminütigen Schnitt zu sehen, bei dem so etwas wie Handlung erkennbar war und die einzelnen, von mir hundertfach durchgenudelten Sprachfetzen aneinandergereiht richtige Dialoge ergaben. Das war wie eine Erlösung, bei der etwas Aufgestautes endlich in Fluss kam. Wie das endlich zum Teil erkennbare Detail eines großen Puzzles, mit dessen abstrakt wirkenden Einzelteile man sich viel zu lang beschäftigt hatte. Am nächsten Tag ging es dann weiter mit der eintönigen Konzentration auf die einzelnen Puzzleteile, und schon morgens sehnte ich den Moment herbei, wenn ich später am Vormittag mal zur Toilette gehen würde, über den mit Linoleum ausgekleideten Gang, vorbei an den anderen Schneideräumen, aus denen fremde Sprachfetzen und Filmspulgeräusche drangen, und mich während dieser wertvollen Minuten auf mich selbst besinnen, mich daran erinnern durfte, dass ich eigentlich jemand anderes war als diese Erna, die sich selbst bei einfachsten Aufgaben nicht besonders geschickt anstellte. Jemand mit einer Begabung. Auch wenn momentan nicht klar war, wie sie diese Begabung einsetzen oder entwickeln konnte. Wenn ich abends mit der Straßenbahn abends zurückfuhr in mein Zimmer am unteren Ende der Prinzregentenstraße, Camus’ ›Der Mythos von Sisyphos.‹ Und alle paar Tage telefonierte ich mit meinem Mann. Mobiltelefone gab es noch nicht und Ferngespräche waren teuer. Ich hatte kaum Geld, was mir jedoch nur in den Momenten auf dem Heimweg von der Arbeit etwas ausmachte, wenn ich in den Fenstern der teuren Cafes am Max Weber Platz die schön gekleideten Menschen sah, die es sich leisten konnten, dort ein Glas Sekt zu trinken und eine Kleinigkeit zu essen. Mein Luxus war die morgendliche Butterbrezel am Stehtisch einer feinen Bäckerei, und der Eintopf in der Bavaria Kantine war in Ordnung. Einmal blieb ich aber in der Mittagspause mal im Schneideraum, um meinen Schneidetisch zu zeichnen, inmitten einer sanften weiten Hügellandschaft. Ich machte die Zeichnung auch, um der Cutterin zu zeigen, dass Erna keine komplette Versagerin ist, sondern dass es auch etwas gibt, das sie kann. Der Moment, in dem die Cutterin die Zeichnung sah, den Mund erst öffnete, dann schloss und schweigend nickte, öffnete sich in meinem Kopf zu einer wunderbaren Riesenblase heilsamer Genugtuung, zu der ich in den kommenden Tagen immer wieder Zuflucht suchte. Und selbst das Schimpfen schien in den Hintergrund gerückt. Am Ende des Praktikums, noch bevor ich sagen konnte, dass der Schneideraum nichts für mich ist, sagte die Cutterin, der Schneideraum sei nichts für mich. Mit ihrer künstlerischen Begabung sollte Erna doch zur Ausstattung gehen. Ausstattung? Ja, Requisite und so. Es begännen jetzt die Vorbereitungen für einen 90-Minüter über das Erlanger Baby. Sie wissen schon, das Baby im Bauch der toten Mutter. Ein ethischer Konflikt, der ein paar Jahre zuvor durch die Presse gegangen war. Ich erinnerte mich nicht. Mit Baby und tote Mutter assoziierte ich gleich wieder Zweifel, ob Ausstattung etwas für mich sein könnte – oder doch nur eine weitere Erfahrung, die beweisen würde, dass ich für nichts richtig geeignet bin. Die Cutterin schaute mich an, und ihre stahltischblauen Mausaugen schienen mir zum ersten Mal warm und freundlich. Sie sagte, sie habe schon mit dem Ausstatter gesprochen, er könne eine Praktikantin gebrauchen.